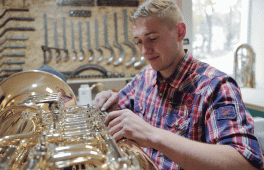Stammt die Tuba aus der Antike? Jedenfalls bliesen schon vor 2.000 Jahren die alten Römer bei ihren Feldzügen auf einer Art Trompete, die sie „Tuba“ nannten – abgeleitet von „tubus“, dem lateinischen Wort für „Röhre“: ein primitives Rohr aus Bronze mit einem Mundstück auf der einen und einem Schalltrichter auf der anderen Seite. Auch die Tuba von heute ist, wie jedes Blechblasinstrument, nichts anderes als eine lange Messingröhre, nur eben so gebogen, dass sie in Form und Größe für Spielende handhabbar wird. Würde man sie auf die gleiche Art bauen wie das antike Instrument, wäre sie in ihrer kleinsten Ausprägung mit 3,5 Metern ungefähr so lang wie ein Alphorn – und weder bei der Marschmusik noch im Orchestergraben oder sonst auf einem ihrer vielen Einsatzgebiete zu gebrauchen. Fazit: Mit der römischen Vorfahrin verbindet sie nicht mehr als Hörner, Trompeten oder Posaunen, in Wirklichkeit blickt die Tuba von allen Mitgliedern der Blechbläserfamilie auf die kürzeste Geschichte zurück.
Sonorer Bass im Chor der Blechblasinstrumente
Entwickelt wurde die Tuba im Umfeld der Militärmusik. Anfang des 19. Jahrhunderts hatte hier als Bassinstrument die Ophikleide Einzug gehalten, eine französische Erfindung, die in Klang und Handhabung an eine Kreuzung aus Fagott und Baritonsaxofon erinnert. Sie stellte zwar eine deutliche Verbesserung zu vorangegangenen Alternativen dar. Doch auch sie klang ziemlich rau, war wenig durchsetzungsfähig und intonationssicher, weshalb in den 1830er-Jahren der preußische Militärkapellmeister Wilhelm Wieprecht den Instrumentenbauer Johann Gottfried Moritz mit der Konstruktion eines neuen Musikinstruments beauftragte. Es sollte kräftig und rund klingen, ganz aus Metall gefertigt sein und über die damals neuartige Ventiltechnik verfügen (die Ventile werden von der/dem Spielenden gedrückt und dienen dazu, die Rohrlänge eines Blechblasinstruments flexibel zu verändern und ein gleichmäßiges Spiel aller zwölf Töne der chromatischen Tonleiter über mehrere Oktaven zu ermöglichen). Am 12. September 1835 erhielten Wieprecht und Moritz das Patent für die erste Basstuba in F mit fünf Ventilen – und schufen so das Instrument, das dem Chor der Blechblasinstrumente die lang ersehnte sonore Bassstimme hinzufügte.
Je nach Stimmung reicht der Tonvorrat der Basstuba vom Kontra-B bis zum eingestrichenen g (F-Stimmung) bzw. vom Kontra-As bis zum eingestrichenen f (Es-Stimmung). Doch es geht noch tiefer: Rund ein Jahrzehnt nach Erfindung der Urform meldete der tschechische Instrumentenbauer Václav František Červený die Kontrabasstuba in B zum Patent an, die als einziges Orchesterinstrument neben dem Kontrafagott und (je nach Besaitung) dem Kontrabass auch die Subkontraregion erreicht – mit anderen Worten: Sie kann Töne spielen, an denen selbst ein Klavier an seine Grenze stößt. Kein Wunder, dass nicht nur Militärmusiker von den Möglichkeiten der kolossalen Neuerfindung begeistert waren, sondern auch Komponisten von Opern und sinfonischen Werken die Tuba, sowohl in Bass- als auch Kontrabassausführung, bald für sich entdeckten. Schon 1844 hebt Hector Berlioz in seiner „Instrumentationslehre“ die neu erworbene Stellung der Basstuba im Orchester hervor – und stellt bei der Gelegenheit auch die vom belgischen Instrumentenbauer Adolphe Sax (jawohl, dem Saxofon-Erfinder) hergestellten Saxhörner daneben: Wenn man so will, eine französische Unterart der Tuba in verschiedenen Ausführungen. Als Tubakomponist der ersten Stunde darf Richard Wagner nicht unerwähnt bleiben, der sie in all seinen großen Musikdramen zum Einsatz bringt. Als „Stimme“ des garstigen Lindwurms Fafner übernimmt die Basstuba in seiner Oper „Siegfried“ sogar solistische Aufgaben. Apropos Wagner: Die nach ihm benannten Wagner-Tuben sind keine Abkömmlinge der Tuba, sondern eher so etwas wie modifizierte Waldhörner.
Wie sieht es generell mit den Familienverhältnissen der Tuba aus? Nun ja, wie in den meisten Familien sehr bunt. Neben den gleichberechtigt vorkommenden Bauformen als Bass- und Kontrabasstuba gibt es noch weitere Größen wie die (überaus seltene) Subkontrabasstuba, aber auch kleinere Formen wie die Bariton- und die Tenortuba oder das Euphonium, die besonders in Marschkapellen bzw. deren amerikanischen Pendants, den Marching Bands, sehr beliebt sind. Da gleichzeitiges Marschieren und Tubaspielen bei größeren Instrumenten nicht so einfach ist, entwickelten sich bald schon tragbare Varianten, die sich die Spielenden bequem „um die Hüften legen“ konnten. Die bekannte ovale Form der Tuba ist hierbei gerundet, neben dem Helikon, dessen Schalltrichter zur Seite geht, gibt es noch das Sousaphon – benannt nach dem legendären amerikanischen Militärmusiker John Philip Sousa („Stars and Stripes forever“) –, bei dem der Schalltrichter nach vorne gerichtet ist. Zählt man die Tuba nun eigentlich zu den Trompeten- oder den Posauneninstrumenten? Weder noch, als Mitglied der Familie der „Bügelhörner“ ist sie entfernt mit dem Horn und näher mit anderen Militärinstrumenten wie dem Kornett verwandt.
Von Dixieland bis Kammermusik
Wie dieses fand die Tuba als eines der ersten Instrumente Einzug in eine Musikrichtung, die um 1900 in den amerikanischen Südstaaten entstand: dem Jazz. Hier übernahm sie eine Zeit lang die Rolle des Standard-Bassinstruments, bis sie in den 1920er-Jahren immer mehr vom Kontrabass ersetzt wurde. Ganz verschwunden ist sie aber nie, teilweise kehrte sie sogar als Solistin mit waghalsigen Improvisationen zurück, und bis heute stellt sie ihren markanten Sound in den Dienst jeder klassisch besetzten Dixieland-Band. Ihren schnell eingenommenen Stammplatz im Militärwesen und im klassischen Orchester hat die Tuba nie verlassen, was auch für „zivile“ Profi- und Amateurblasorchester gilt, wo sich das Instrument ebenfalls unentbehrlich machte. Ob in Schützenzügen, Karnevalskapellen oder den Posaunenchören der evangelischen Kirche: Ohne Tuba würde hier das Fundament fehlen – sie ist es, die einem reichen Blech- oder gemischten Bläserensemble erst den vollen und runden Klang gibt.
Zugegebenermaßen beschränken sich die Aufgaben der Tuba häufig darauf, den darüberliegenden Instrumenten mit kräftig intonierten Basstönen eine harmonische und rhythmische Stütze zu geben. Ein Schicksal, dass sich die Tuba mit vielen Bassinstrumenten teilt, zumal viele Komponist:innen nicht einmal wissen, wie flink und beweglich sich erfahren Spieler:innen auf diesem Instrument bewegen können – und dass es abseits der tiefen Regionen noch weitere reizvolle Register gibt, in denen die Tuba regelrecht zur Sängerin werden kann. Zwar klein, aber umso feiner ist das Repertoire, in dem die Tuba im Vordergrund steht. Im Bereich der Kammermusik ist etwa die Sonate für Tuba und Klavier von Paul Hindemith ein echter Klassiker geworden. Glenn Gould etwa, der berühmte Pianist, war so fasziniert von diesem Werk, dass er es zusammen mit Hindemiths anderen Blechbläsersonaten einspielte. Doch auch im großen Konzertsaal lässt sich die Tuba manchmal solistisch vernehmen, wenn es auch bis 1954 dauerte, bis der britische Komponist Ralph Vaughan Williams das erste Tuba-Konzert der Musikgeschichte vorstellte. Heute gilt das in tubafreundlichem f-Moll gehaltene Werk als bekanntester Vertreter dieser Gattung neben dem von John Williams (Hollywoods Allroundkomponisten von „Star Wars“ bis „Harry Potter“) komponierten Tuba-Konzert aus dem Jahr 1985.